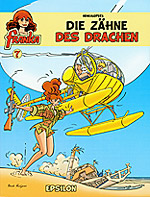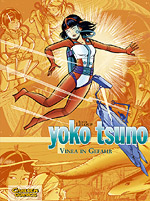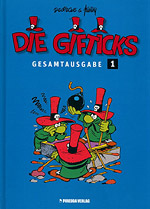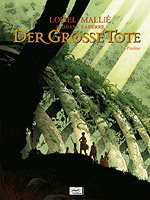Samstag, 29. August 2009
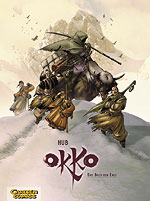 Die Frau, die in dem kleinen natürlichen Tümpel ein Bad nimmt, sieht wunderschön aus. Obwohl ein Makel diese Schönheit stört, ihr fehlt ein Arm, können die Männer nicht den Blick abwenden. Setzuka bemerkt die versteckten Männer bald. Sie erwidert die Blicke der ungebetenen Besucher stoisch. Nichts scheint ihre beherrschung durchbrechen zu können. Kurz darauf, Okko und seine kleine Gruppe wurden unter Setzukas Dach eingeladen, erfolgen wenig freundschaftliche Gespräche. Aber das alles spielt bald auch keine Rolle mehr. Das Lager wird angegriffen. Aus den Kriegern, die offensichtlich nicht viel füreinander erübrigen können, werden zwangsweise Verbündete: Die Toten greifen an!
Die Frau, die in dem kleinen natürlichen Tümpel ein Bad nimmt, sieht wunderschön aus. Obwohl ein Makel diese Schönheit stört, ihr fehlt ein Arm, können die Männer nicht den Blick abwenden. Setzuka bemerkt die versteckten Männer bald. Sie erwidert die Blicke der ungebetenen Besucher stoisch. Nichts scheint ihre beherrschung durchbrechen zu können. Kurz darauf, Okko und seine kleine Gruppe wurden unter Setzukas Dach eingeladen, erfolgen wenig freundschaftliche Gespräche. Aber das alles spielt bald auch keine Rolle mehr. Das Lager wird angegriffen. Aus den Kriegern, die offensichtlich nicht viel füreinander erübrigen können, werden zwangsweise Verbündete: Die Toten greifen an!
Wer die opulenten chinesischen Kinoepen mag, wird Okko lieben. Autor und Zeichner Hub hat hier eine Geschichte geschaffen, die nicht nur von ihrer Andersartigkeit und Abenteuerlichkeit lebt. Sie dreht sich auch wie eine Spirale in immer größere Höhen, mit immer neuen Überraschungen, mit fein gesponnen phantastischen Elementen und einer Gruppe, die sich aus gut aufeinander abgestimmten Charakteren zusammensetzt.
Wer hier genauer hinsieht, wird natürlich gleich Parallelen zu Rollenspielen gleich welcher Art herstellen. Aber auch zu Ur-Gruppen wie den Mannen um einen Robin Hood lassen sich Verbindungen herstellen. Ein Anführer, ein riesenhafter Kämpfer, ein Mönch und sein Lehrling und brandneu dabei: Eine schlagfertige Frau, die sich in der unwirtlichen Gegend, der Kulisse dieses Abenteuers, auskennt. Die Aufgabe, die sich Okko, der herrenlose Samurai und Anführer, selbst gestellt hat, ist das Auffinden und Bestrafen zweier seltsamer Mönche, die das Zeichen des Raben benutzen.
Leider scheint niemand einen Orden mit diesem Zeichen zu kennen. In den Bergen existieren sieben Klöster. Trotz der widrigen Wetterumstände will Okko alle Klöster besuchen, um den Orden zu finden. Hub, der das Szenario alleine geschrieben hat und nur bei dem Storyboard mit Emmanuel Michalak zusammenarbeitete, schafft nicht nur ein sehr düsteres Abenteuer, sondern auch eine sehr lebensfeindliche Welt, die den Protagonisten alles (wirklich alles) abverlangt. Hier entsteht sehr schnell eine endzeitliche Stimmung. Die Wege, die gezeigt werden, sind lang, schmal, zerklüftet. An jeder Ecke atmet es Beschwerlichkeit.
Die Landschaft stellt sich gegen die Helden, aber auch andere Schwierigkeiten warten. Hier wird es weitaus phantastischer und gruseliger. Dämonen und lebende Tote greifen die Helden an, wunderbar phantasievoll gestaltet. Sie sind das Gegenstück zum riesigen Noburo, dessen Gesicht immer von einer dämonischen Maske verdeckt wird. Hub umgibt seine Helden mit Rätseln, er hält sie undurchsichtig, obwohl sie zu den Guten gehören. So sind die Fähigkeiten von Noburo faszinierend. Im Kampf ist er ein Gigant. Er steckt Verletzungen weg. Hinter der Maske kann sich der Leser regelrecht eine brummige, fast schon leidenschaftslose Stimme vorstellen.
Eine schöne Idee ist Nuuk, ein Nezumi (eine Ratte, die durch jahrelange Dressur sogar leidliches Sprechen gelernt hat). Nuuk ist eines jener Elemente in einer Handlung, die zunächst nettes Beiwerk sind, sich aber als I-Tüpfelchen entpuppen, indem sie zur rechten Zeit am rechten Ort zur Warnung oder als Triebfeder dienen.
Stephane Pelayo unterstützt Hub bei der Kolorierung. Die Farben sind um Düsternis bemüht. Lila, dunkles Blau, Ocker, dunkles Türkis und kaltes Braun stehen allenfalls einem dunklen Rot und einem mehr oder minder leuchtenden Orange gegenüber. Zuerst werden Kämpfe, kleine Auseinandersetzungen gestaltet, später sind es Scharmützel, bis im Finale eine ausgewachsene Schlacht daraus, die wider Erwarten am Tage stattfindet und trotzdem einen düsteren Eindruck hinterlässt. Denn der Feind greift in der gleichen Farbe wie der staubige, unfruchtbare Boden an. Diese Bilder reichert Hub mit kleinen Details an. Massenszenen und Breitwandbilder liegen ihm. Hier agiert er wie ein Regisseur, der nicht kleckern, sondern klotzen will.
In allen Belangen, auf der Erzählebene wie auch auf der grafischen Ebene, wunderbar gemacht, für Fans chinesischer Fantasy perfekt. Spannend von der ersten bis zur letzten Seite (eher lässt es sich nicht weglegen), mit einem sehr dunklen Flair umgesetzt. Noch besser als der erste Teil (dessen Lektüre nicht Pflicht ist, aber es steigert den Lesegenuss). 🙂
Okko 2, Das Buch der Erde: Bei Amazon bestellen
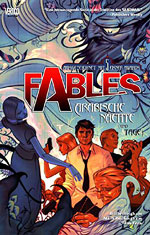 Ein Dschinn ist etwas ganz besonderes, selbst für die Begriffe eines Fables. Die alte Dame beschreibt die Fähigkeiten dieser Flaschengeister in den dunkelsten Farben. Keinen Sinn für Moral oder den Unterschied zwischen Gut und Böse besäßen sie, dafür eine Allmacht ohnegleichen. Einstmals wurden sie ausgetrickst und in kleine Flaschen verbannt. Wer sie befreite, dem sollten drei Wünsche erfüllt werden. Solange der dritte Wunsch dazu benutzt wird, den Geist wieder in die Flasche zu befördern, kann niemals ein Unglück geschehen. Aber werden alle Nutzer der Flaschengeister auch so klug sein? Fest steht: Ein Dschinn besitzt uneingeschränkte Macht, mit der es ein Leichtes wäre, ein ganzes Land in Nullkommanichts auszulöschen.
Ein Dschinn ist etwas ganz besonderes, selbst für die Begriffe eines Fables. Die alte Dame beschreibt die Fähigkeiten dieser Flaschengeister in den dunkelsten Farben. Keinen Sinn für Moral oder den Unterschied zwischen Gut und Böse besäßen sie, dafür eine Allmacht ohnegleichen. Einstmals wurden sie ausgetrickst und in kleine Flaschen verbannt. Wer sie befreite, dem sollten drei Wünsche erfüllt werden. Solange der dritte Wunsch dazu benutzt wird, den Geist wieder in die Flasche zu befördern, kann niemals ein Unglück geschehen. Aber werden alle Nutzer der Flaschengeister auch so klug sein? Fest steht: Ein Dschinn besitzt uneingeschränkte Macht, mit der es ein Leichtes wäre, ein ganzes Land in Nullkommanichts auszulöschen.
Eine Lösung zur Bekämpfung eines Dschinns gibt es: Einen anderen Dschinn. Dieser könnte einen anderen Geist besiegen, doch nur um den Preis seiner eigenen Existenz. So ein Geist wird nichts zu finden sein. Sinbad, der Anführer der arabischen Fables-Delegation weiß von den Machenschaften seines Ratgebers nichts. So müssen sich die Einwohner von Fabletown etwas anderes einfallen lassen.
Bill Willingham würzt die bekannten Handlungsstränge mit neuen Nebenschauplätzen und Bedrohungen. Im Verlauf der Geschichte um Fabletown hat sich einiges verändert. Wahlen haben die Machtverhältnisse verschoben. Ein Krieg und ein Überfall mussten überstanden werden. Blue Boy absolvierte einen privaten Rachefeldzug. Daneben gab es die kleinen und großen Tragödien, Herzschmerz und Trennungen. Auf diesem Feld stehen die Fables den Menschen in nichts nach, ganz besonders dann nicht, wenn Figuren wie Prince Charming hinter jedem Frauenrock her sind, die es nicht bei Drei auf die Bäume schaffen.
Nun also geben sich arabische Fables ein Stelldichein. Während in Bagdad noch amerikanische Soldaten patrouillieren macht sich ein Dschinn daran seinen Auftrag auszuführen und verwirrt die ausländischen Soldaten mit einem irritierenden Äußeren einer Schönheit aus Tausendundeiner Nacht. Willingham vermengt spannende Ereignisse mit dem Zusammenprall zweier vollkommen unterschiedlicher Zivilisationen und kultureller Eigenschaften. Daraus entstehen wieder humorvolle Situationen, die so ungewöhnlich sind, dass sie sich nicht mit anderen Publikationen vergleichen lassen. Mit den Fables geht Willingham jeder Vergleichsmöglichkeit aus dem Weg, so frisch und neu (und gut) ist da gesamte Szenario.
Gleich zu Beginn wird die mangelhafte Umgangsform der Fables aus Fabletown einerseits und die ebenso mangelhafte Flexibilität der arabischen Fables andererseits einander gegenüber gestellt. Die einen vergessen, ihre arabischen Gäste angemessen zu empfangen, die anderen wollen nicht eher aus ihrer Limousine steigen, ehe sie nicht angemessen empfangen werden. So wissen die drinnen im Haus nichts von ihren Gästen und die in der Limousine werden langsam sehr wütend. Am Ende ist es ausgerechnet Flycatcher, der als Hausmeister arbeitet, derjenige, der die Gäste durch sein Verhalten zum Aussteigen zwingt. Es ist nur eine ganz kleine Episode aus sehr vielen, die hier sinnbildlich für den sehr verschachtelten und sehr durchdachten Aufbau des ganzen vorliegenden Bandes steht.
Fabletown besticht durch gezügelte Fantasie. Hier leben diejenigen, die inmitten normaler Menschen nicht auffallen und sich durch das Stadtbild bewegen können, ohne angestarrt zu werden. Weitaus interessanter (auch optisch) ist die Farm außerhalb der Stadt. Mark Buckingham, der hier grafisch mit den arabischen Fables eine schöne neue Aufgabe hat, geht in der Optik der Farm viel stärker auf. Allein die Kinder von Snow White sind wohl der fantasievollste Nachwuchs der letzten Jahre. Buckingham zeichnet mit einem zarten Realismus an der Grenze zum Bilderbuch. Die Bilder wirken zerbrechlich und sind stets nur mit dem nötigen Strich versehen. Gleichzeitig sind die einzelnen Charaktere sehr ausdrucksstark geworden. Buckingham beherrscht tolle Gesichtsausdrücke und auch die leichten Veränderungen. So entsteht abseits der Erzählung viel Atmosphäre und Tiefe.
Eine äußerst gelungene Begegnung unterschiedlicher Fable-Kulturen. Willingham setzt wieder einige punktgenaue Clous und treibt die Handlung unangestrengt wie auch an jeder Stellen abwechslungsreich voran. Prima. 🙂
Fables 8, Arabische Nächte (und Tage): Bei Amazon bestellen
Donnerstag, 27. August 2009
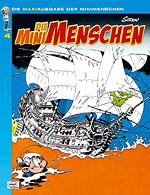 Es war im Dezember 1941, als der britische Angriff auf ein deutsches Tankschiff stattfand. Leider verschwand dabei auch das britische Jagdflugzeug mit der Kennung Moskito 417. An Bord befand sich der Vater von Andreas, eines der Minimenschen. So lange hat Andreas schon in der Umgebung des Angriffs nach seinem Vater gesucht und nichts gefunden. Doch heute hat er dazu einen neuen Verbündeten: Renaud. Und Renaud liebt scheinbar aussichtslose Aufgaben. Eine weitere Suche beginnt.
Es war im Dezember 1941, als der britische Angriff auf ein deutsches Tankschiff stattfand. Leider verschwand dabei auch das britische Jagdflugzeug mit der Kennung Moskito 417. An Bord befand sich der Vater von Andreas, eines der Minimenschen. So lange hat Andreas schon in der Umgebung des Angriffs nach seinem Vater gesucht und nichts gefunden. Doch heute hat er dazu einen neuen Verbündeten: Renaud. Und Renaud liebt scheinbar aussichtslose Aufgaben. Eine weitere Suche beginnt.
Piraten! Seron ist mit diesem Thema aktueller denn je. Ein großer weißer Zweimaster zieht seine Bahn über das Meer und taucht dort auf, wo etwas zu holen ist: Er überfällt moderne Kreuzfahrtschiffe. Pierre Seron und Hao nehmen ihre damals wahrscheinlich meist jugendlichen Leser mit auf eine Schauermähr Reise, auf der ihr kleiner Held Renaud eine weitere seiner unheimlichen Begegnungen hat. Diesmal allerdings handelt es sich wieder um ein Sahnehäubchen.
Alles beginnt, wie stets bei Seron und seinen kreativen Mitstreitern, ziemlich normal. Hier ist es ein kleines Walfangboot, das den Blick des Betrachters auf sich zieht. Aber es ist auch ein sehr kleines Walfangboot, so klein, wie es eben bei Minimenschen aus Eslapion (der kleinen Stadt der Minimenschen) der Fall ist. In einem solchen Fall wird ein Thunfisch zum Wal. Und wie einst der weiße Wal geht auch dieser Thunfisch mehr als nur rabiat mit dem Schiff und seiner Besatzung um. Alleine daraus ließe sich schon eine Geschichte entwerfen. Aber Seron und Hao ist das alles noch zu normal. Wenig später wandelt sich der Auftakt in eine Suchaktion, die so auch aus dem Nebel des Grauens entliehen sein könnte.
Im Zuge der Erarbeitung des Rätsels Lösung kommen selbstverständlich wieder eine ganze Reihe von Fluggeräten zum Einsatz. Außerdem ist eine ausgefeilte Technik letztlich der Kern des Geheimnisses. Weniger gruselig (und in gewisser Weise mit dem Abenteuer um das Geisterschiff verbunden) verläuft das Abenteuer Das Auge des Zyklopen. Dafür ist es technisch aufwändiger (für jene, die mitspielen) und auch grafisch etwas darstellungsfreudiger. Eine Illusionsmaschine sorgt für falsche Einsichten wie Häuser, Straßenzüge, Fahrzeuge und Menschen. Ausgerechnet ein Großer bildet mit seinen Erlebnissen den Auftakt der Handlung. Hier könnten die Einfälle eines Fantomas in der Komödientrilogie mit Louis de Funes Pate gestanden haben. Wenn den eigenen Augen nicht mehr zu trauen ist und plötzlich eine Freiheitsstatue auf der grünen Wiese steht, dann haben Seron und Hao wieder zugeschlagen und treiben einen blendenden Schabernack mit ihren Lesern.
Nicht nur die technischen Zeichnungen, die Kulissen aus Landschaft, Fahrzeugen, Städten und anderem haben es Seron angetan. Zwischendurch menschelt es ordentlich. So oft auch diverse Luftflitzer zum Einsatz kommen (besonders gerne Jagdflieger aus dem Zweiten Weltkrieg oder auch die heißgeliebte Mirage), so gut arbeitet Seron auch mit seinen Charakteren. Neben wiederkehrenden Figuren, allen voran natürlich Renaud, bemüht sich Seron auch um die Nebenrollen. Gleich mit der Kurzgeschichte Das Haus zum grünen Zahn werden alle Beteiligten sorgsam etabliert. Die Geschichte um einen entführten Jungen ist so aufgebaut, dass der Leser zu jeder Zeit den Fieslingen ihr Schicksal so richtig gönnt.
Aber der Spaß steht bei aller Ernsthaftigkeit manches Themas natürlich im Vordergrund. Dies betrifft die kleinen Geschichten Keine Violine für den Geiger, Das Haus der Stahls und erst recht Eine schlumpfige Reise, in der die kleinen Menschen auf die kleinen Schlümpfe treffen. Hier holen Seron und Hao einiges aus dem Crossover heraus, aber bestimmt nicht alles. Es muss ihnen zugute gehalten werden, dass ihnen auch schlicht der Platz fehlt. Beide Seiten hier zusammengebracht hätten eine bombastische Geschichte ergeben können. So liegt der Schwerpunkt auf Klamauk, der jedoch vorzüglich gelingt.
Kleine Klassiker, so steht es auf der Rückseite des vorliegenden Bandes. Treffender ließe es sich nicht sagen. Die Minimenschen sind zeitlose Klassiker und längst den Kinderschuhen entwachsen, für die sie einmal gedacht waren. Diese Komik funktioniert in allen Altersstufen. Ein schöner frankobelgischer Humor, uneingeschränkt empfehlenswert. 🙂
Die Maxiausgabe der Minimenschen 4: Bei Amazon bestellen
Dienstag, 25. August 2009
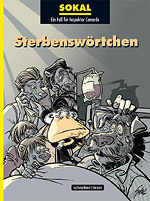 Eugen liegt im Sterben. Kein Wörtchen dringt mehr über seine Lippen, nur noch einige sinnlose Laute. Eugens Geist scheint längst weggedriftet zu sein. Dieser Zustand setzt seine Tochter und ihren Mann in höchste Alarmbereitschaft, denn der alte Mann hat noch nicht alle nötigen Informationen preisgegeben. Ein Detektiv muss her. Die Aufgabestellung ist recht einfach. Eugen war ein Kriegsheld, kämpfte im französischen Widerstand des Zweiten Weltkriegs und jagte den Nazis eine ordentliche Ladung Goldbarren ab. Und von diesen fällt bis zum jetzigen Tag jede Spur. Canardo kann die Sorge der Familie verstehen. Aber was kann er da tun?
Eugen liegt im Sterben. Kein Wörtchen dringt mehr über seine Lippen, nur noch einige sinnlose Laute. Eugens Geist scheint längst weggedriftet zu sein. Dieser Zustand setzt seine Tochter und ihren Mann in höchste Alarmbereitschaft, denn der alte Mann hat noch nicht alle nötigen Informationen preisgegeben. Ein Detektiv muss her. Die Aufgabestellung ist recht einfach. Eugen war ein Kriegsheld, kämpfte im französischen Widerstand des Zweiten Weltkriegs und jagte den Nazis eine ordentliche Ladung Goldbarren ab. Und von diesen fällt bis zum jetzigen Tag jede Spur. Canardo kann die Sorge der Familie verstehen. Aber was kann er da tun?
Eine Menge! Doch das kann das Ehepaar für einhundert Dollar Kosten am Tag kaum ahnen. Seit kurzem ist Canardo im Besitz eines Prototypen, der Zeitsprünge ermöglicht. Was wäre besser, als ihn gerade jetzt einzusetzen, bei einer Spur, die geradewegs in die Vergangenheit, genauer in die letzte Etappe des Zweiten Weltkriegs führt. Canardo sucht das Haus des alten Eugen auf und sieht sich um. Kurz darauf stellt er das Zieldatum seines Zeitsprunggerätes auf den 1. Juni 1944. Nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage ertönt ein Psch, es macht mehrere Male Bzzz und schließlich (Canardo mag es kaum glauben, ist aber erleichtert) landet der Detektiv mit dem gewohnt gelangweilten Blick pünktlich am Ziel.
Name: Eugen Molard. Vergangenheit: Kriegsheld. Völlig unbeeindruckt, selbst durch die Möglichkeiten der Aufklärung des vor ihm liegenden Rätsels, macht sich Canardo ans Werk. Und gerade diese Schnoddrigkeit ist es, die den Begegnungen von Canardo und Molard in den folgenden Jahrzehnten ihre ganz besondere Würze gibt. Nach und nach entschlüsselt Autor und Zeichner Benoit Sokal das Leben eines Franzosen, der zeitweise gefeiert wurde und schließlich ein ganz normales französisches Leben führte, einen eigenen Weinkeller inklusive.
Sokal, der sich für seine Krimireihe der Tiermenschen bedient und damit die Klassiker des Cartoons karikiert, hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er einen scharfen Blick auf das gesellschaftliche Leben hat. Ob es um das übliche Miteinander geht, Politik oder Terrorismus, manchmal ganz einfach nur Mord, stets blickt Sokal mit scharfen Auge hinter die bürgerlichen und gesellschaftlichen Fassaden und erzählt darüber mit scharfer Zunge und süffisantem Ton. Immer schwingt eines mit: Man kann diese Welt nicht ernst nehmen.
Wenn es mal wirklich lebensbedrohlich wird, läuft Canardos Selbstbeherrschung schon mal aus dem Ruder. Ansonsten ist er die Ruhe selbst. Sicherlich sind Canardos Auftraggeber die Initiatoren der Geschichte, das Gegengewicht zu Canardo ist jedoch der alte Eugen, den der Leser von Zeitsprung zu Zeitsprung durch die Jahrhunderte begleitet. Interessant ist, wie Eugen mit dem Gold umgeht, dass er den Nazis abgenommen hat: Nämlich gar nicht. Anstatt mit Fug und Recht ein schlechtes Gewissen zu haben, nutzt er das Gold, das ihm ein völlig anderes Leben beschert hätte, überhaupt nicht. Lieber verbleibt er in der Spur seines gewöhnlichen Lebens, nach dem Krieg nicht weiter beachtet und ansonsten auch nicht weiter respektiert, nicht einmal von seiner eigenen Familie.
Was sich hier als Kritik einer ernsten Geschichte lesen mag, ist in der Handlung selber stets mit einem kleinen gemeinen Humor durchsetzt. Gerade das macht diese (wie auch die anderen) Handlung so gut. Das leise Kratzen an der Fassade, unterstützt durch den Einsatz einer brandneuen Technik, die in ihrem ersten Test ausgerechnet einen Nationalhelden, einen ehemaligen Widerständler entlarvt. Sokal setzt die Geschichte wie gewohnt in fetten und ausdrucksstarken Strichen um. Seine Tiermenschen sind extra überzogen dargestellt, immer ist ihr Charakter ihnen ins Gesicht gebrannt. Tränen fließen hier schnell (sie hüpfen optisch geradezu davon). Stellvertretend für den Leser glaubt Canardo diesen Trauerbekundungen nicht. Eugens Leben hinterlässt einen grauen optischen Gesamteindruck. Nur ab und zu blitzt etwas Leben durch, wie in jener Szene, als das Versteck des Goldes gelüftet wird und sein Strahlen verheißt, was alles sein könnte, aber nicht ist.
Beinahe ein dunkles Märchen, weiterhin brillant von Sokal erzählt und illustriert, mit vielen Nuancen fast schon sezierend, aber immer unterhaltend und stets für ein Schmunzeln gut. So kennt der Leser seinen Canardo und nicht anders sollte er sein. Kult. 🙂
Ein Fall für Inspektor Canardo 11, Sterbenswörtchen: Bei Amazon bestellen
Oder bei Schreiber und Leser.
Montag, 24. August 2009
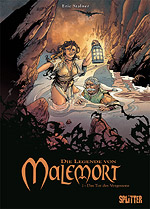 Der Scheiterhaufen von Malemort ist mehr als eine Erinnerung. Allein das Bild weckt das Grauen in jenen, die diesen Tag überlebten und der Heiligen Inquisition und ihren Häschern entgingen. An der Vorgehensweise der Inquisition hat sich seither nicht viel geändert. Sie ist ebenso unnachgiebig und grausam. Mit Aymon de Montgarac steht ihr ein Mann vor, der unerbittlich jene jagt, die er im Bunde mit dem Teufel wähnt. Ritter Malperthuis hatte das Pech in seine Fänge zu geraten. Angeschlagen wie der Ritter ist, ohne Waffen und gegen eine Übermacht stehend, müssen er und die ebenfalls gefangene Agnes, Antheas Mutter, ihrem Schicksal harren.
Der Scheiterhaufen von Malemort ist mehr als eine Erinnerung. Allein das Bild weckt das Grauen in jenen, die diesen Tag überlebten und der Heiligen Inquisition und ihren Häschern entgingen. An der Vorgehensweise der Inquisition hat sich seither nicht viel geändert. Sie ist ebenso unnachgiebig und grausam. Mit Aymon de Montgarac steht ihr ein Mann vor, der unerbittlich jene jagt, die er im Bunde mit dem Teufel wähnt. Ritter Malperthuis hatte das Pech in seine Fänge zu geraten. Angeschlagen wie der Ritter ist, ohne Waffen und gegen eine Übermacht stehend, müssen er und die ebenfalls gefangene Agnes, Antheas Mutter, ihrem Schicksal harren.
Ein alter hohler Berg dient als Verlies und Folterkammer zugleich. Immer und immer tiefer geht es hinein und hinab. Je weiter die Gefangenen in diesen Schlund geführt werden, desto mehr schwindet ihre Hoffnung, jemals wieder an die Erdoberfläche zu gelangen. Oben sind Anthea und Arnulf weiter auf der Suche nach den beiden Entführten. Anthea wird von ihrer Sorge übermannt und gerät mit ihrem Begleiter, der besonnen vorgehen möchte, in Streit. Es ist keine glückliche Zeit. Und in der Tat: Wenig später stecken Anthea und Arnulf wieder bis zum Hals in Ärger, ohne zu ahnen, dass sie dadurch ihrem Ziel etwas näher kommen.
Aymon de Montgarac und Graf Colbus de Malemort sind die Drahtzieher hinter den Kulissen dieser Geschichte. Montgaracs unversöhnlicher Hass auf Malemort zieht jene, die sich für den Grafen einsetzen in einen Strudel hinab. Die Ursachen für den Zwist reichen Jahrzehnte zurück, wie es sich hier in einer kurzen Begegnung zeigt. Eric Stalner, Autor und Zeichner, lüftet einen Moment lang den Schleier und gibt dem Leser Einblicke in die Gründe für die unglückseligen Umstände, in denen sich Anthea, Arnulf, Agnes und Malerthuis befinden.
Der Kerker wird hier zum zentralen Handlungsort. Wer annehmen mag, dass ein Kerker nicht viel zu bieten habe, täuscht sich in den Ausmaßen. Der Wer hinein ist lang, die Wege drinnen noch länger und es scheint unzählige Zellen und Winkel zu geben. In der Dunkelheit schafft Stalner plötzlich Bedrohungen, die rein gar nichts mit Vampiren zu tun haben. In der Zelle, in die Anthea und Arnulf geworfen werden, gibt es bereits Bewohner. Für diese sind neue Zellenbewohner vor allem eines: Nahrung. Und hier wirft Stalner einmal mehr das alte Konzept des blutsaugenden Vampirs über den Haufen, indem er ihn nicht als Monster, sondern als Retter verwendet.
Das Monster hat seine dunklen Seiten, Stalner kann dies nicht ausblenden. Aber Malemort, der einen schwarzen Umhang über einer weißen Tunika trägt, ist auch jemand, der sich für seine Wesensart schämt. Allerdings lässt diese ihm auch zuweilen keine Wahl. Hier kann der Vampir erstmals so richtig mit aller Macht seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, die sich nicht nur im brutalen Angriff erschöpfen. Malemort ist ein Rhetoriker, eine Respektsperson. Für jemanden, der es nicht besser weiß, wie den kleinen Arvid, der im Kerker aufgewachsen ist, ist Malemort noch etwas anderes: Ein Vogelmensch und somit ein Sinnbild der Hoffnung.
Optisch schafft Stalner einen Ort der Verzweiflung und einen Vorhof zur Hölle. Nach einem kurzen Intermezzo in einer kleinen Ortschaft, deren Tageslicht und Farbenpracht über ihre Gefährlichkeit hinwegtäuscht, gehen die Befürchtungen der Helden (und des Lesers) und die Atmosphäre Seite an Seite. Stalner weiß jedoch die Befürchtungen seiner ihm Anvertrauten zu unterlaufen: Sie sind nämlich noch viel schlimmer. Cineasten mögen vielleicht Vergleiche zu den labyrinthartigen Gewölben aus Der Name der Rose ziehen, vielleicht auch zur Unterwelt unter dem russischen Friedhof in Hellboy. Das grob behauene Gestein wird durch Mauerwerk und Deckenbögen gestützt. Überall warten stählerne Gittertüren auf die Verzweifelten. An den Decken hängen eiserne eierförmige Körbe, wie sie auch in der Realität zur Folter und Gefangenschaft verwendet wurden.
Neben der Kulisse vergisst Stalner keinesfalls die Schergen und Folterknechte, die aus dieser Hölle einen noch unliebsameren Ort machen. Visagen und Fratzen machen aus diesem Ort zusätzlich eine Geisterbahn. Die Farben von Jean-Jacques Chagnaud können hier ihre volle Wirkung entfalten. Magisches Blitzen der Tricks von Malemort erhellen die Dunkelheit, Kerzenschein und Fackelfeuer machen aus dem Kerker einen Glutofen.
Ein sehr guter und hoch spannender zweiter Teil. Anthea und ihre Gefährten können eine Teilaufgabe der Handlung erfüllen, allerdings um einen hohen Preis. Der Gruselfaktor wurde hier deutlich angehoben, dennoch vergisst Stalner die Handlungstiefe nicht und wartet mit so manchen Details auf. Eine tolle Gruselmähr. 🙂
Die Legende von Malemort 2, Das Tor des Vergessens: Bei Amazon bestellen
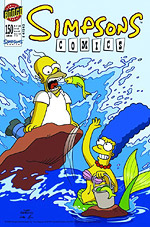 Däumelinchen erträgt es nicht mehr in ihrer Familie. Keiner bemerkt sie. Wenn sie bei Tisch etwas haben will, hört sie niemand. (Obwohl das eine von Homers Grundeigenschaften bei Tisch ist, denn da hat er immer nur das eine zu tun: Essen.) Das klitzekleine Mädchen verlässt das Elternhaus, nur um kurz darauf schon von einem Frosch gefressen zu werden. Und die Moral von der Geschichte … Nein, so schnell geht es dann doch nicht. Däumelinchen ist noch nicht tot. Sie darf zwar nicht spazieren gehen (Anspielung), aber soll verheiratet werden. Und so nimmt doch noch alles eine glückliche Wendung. So sind Märchen eben.
Däumelinchen erträgt es nicht mehr in ihrer Familie. Keiner bemerkt sie. Wenn sie bei Tisch etwas haben will, hört sie niemand. (Obwohl das eine von Homers Grundeigenschaften bei Tisch ist, denn da hat er immer nur das eine zu tun: Essen.) Das klitzekleine Mädchen verlässt das Elternhaus, nur um kurz darauf schon von einem Frosch gefressen zu werden. Und die Moral von der Geschichte … Nein, so schnell geht es dann doch nicht. Däumelinchen ist noch nicht tot. Sie darf zwar nicht spazieren gehen (Anspielung), aber soll verheiratet werden. Und so nimmt doch noch alles eine glückliche Wendung. So sind Märchen eben.
Bleibt alles andersen! Der Märchenman hätte seine helle Freude an der vorliegenden Sammlung umgestrickter Märchen. Die Simpsons räumen immer wieder mal mit Genres oder Persönlichkeiten auf. Mr. Flanders wollte eigentlich nur ein paar christliche Märchen haben und was bekam er vom Internetversandhaus geschickt: Märchen von Hans Christian Andersen. Flander kennt nur eine Lösung:
Das wird eine gute altmodische Bücherverbrennung.
Wie gut, dass sich Lisa Simpson zwischen den Barbecuegrill und die Kleinode der Kinderliteratur stellt. So wird Lisa zur Geschichtenerzählerin. Keine Frage, dass fortan sämtliche Märchencharaktere mit Simpsonsfiguren bestückt sind. Das hat dann sehr merkwürdige Auswüchse zur Folge. Ein nackter Homer geht über Bord und wird von einer Meerjungfrau mit dem Aussehen einer Marge Simpson gerettet. Letztlich frönt dieser Homer dann doch nur einer Leidenschaft: Bier. Die Verhohnepipelung einer kleinen Meerjungfrau ist nur der Auftakt.
Bei den folgenden kleinen Märchen ist die Kenntnis der einzelnen Simpsons-Charaktere kein Muss, aber es hilft doch ein wenig. Denn Ian Boothby (mit Linda Medley) kann sich in dieser Ausgabe nicht davon freisprechen, dass er dieses Blatt ordentlich ins Spiel gebracht hat. Das jeweilige Märchen gibt nur die Rahmenbedingungen vor. Der Prinz auf der Erbse, Das hässliche Entlein, Der Schatten, Däumelinchen und Die gute Mutter bieten darüber hinaus reichlich Platz für Situationskomik. Letztere Geschichte ist ein schönes Beispiel. Weint sich die gute Mutter auch die Augen aus (so dass sie in den Fluss fallen), der Fluss ist, wie er selber sagt, nicht an weiteren Organen interessiert und gibt nicht nur die Augen zurück, sondern lässt die Mutter auch trockenen Fußes passieren (wie einstmals Moses).
Zum Schluss, in der Rahmenhandlung, sobald Lisa den Nachbarsjungen alles erzählt hat, holt auch sie der Alltag wieder ein. Längst haben aktuelle Neuerscheinungen die Märchen von einst eingeholt. Die alten Andersen-Märchen sind viel zu brutal und ängstigend, deshalb sind die Jungen längst in etwas ganz anderes vertieft, sozusagen in etwas biologisch Abbaubares.
Ein mit einem Poster versehener sehr abwechslungsreicher Knaller. Die erste, auch umfangreichste Geschichte dürfte auch die beste sein. Gelacht werden darf wie immer reichlich. Die Kenntnis der einzelnen Figuren wie auch der originalen Märchen selbst kann dabei hilfreich sein. 🙂
Sonntag, 23. August 2009
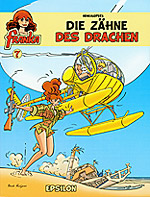 Lord Huttingdon hat so ziemlich alles gejagt, was auf Gottes weiter Erde einem Menschen gefährlich werden und durch eine Kugel aufgehalten werden kann. Doch nun gibt es keine Tiere mehr, die für den Lord noch irgendeinen Reiz darstellen. Ein Kieferfund eines italienischen Wissenschaftlers ändert die Langeweile von Huttingdon. Denn dieser Kiefer verspricht ein neues Jagdziel. Allerdings liegt dieses Jagdziel sehr weit entfernt und scheint auf herkömmliche Weise kaum erreichbar zu sein. Da findet sich plötzlich das für diese Jagdexpedition perfekte Reisegefährt: Ein Wasserflugzeug. Am 8. Dezember 1936 macht sich die Gruppe auf den Weg.
Lord Huttingdon hat so ziemlich alles gejagt, was auf Gottes weiter Erde einem Menschen gefährlich werden und durch eine Kugel aufgehalten werden kann. Doch nun gibt es keine Tiere mehr, die für den Lord noch irgendeinen Reiz darstellen. Ein Kieferfund eines italienischen Wissenschaftlers ändert die Langeweile von Huttingdon. Denn dieser Kiefer verspricht ein neues Jagdziel. Allerdings liegt dieses Jagdziel sehr weit entfernt und scheint auf herkömmliche Weise kaum erreichbar zu sein. Da findet sich plötzlich das für diese Jagdexpedition perfekte Reisegefährt: Ein Wasserflugzeug. Am 8. Dezember 1936 macht sich die Gruppe auf den Weg.
Von der Normalität ins Ungewisse: Franka ist eine Abenteurerin, das ist gar keine Frage, aber hier geht das Abenteuer noch einen Schritt weiter. Durch einen Zufall entdeckt sie in der Fundgrube eines Trödelhändlers einen Kieferknochen, der sie in enorme Schwierigkeiten bringt: Die Zähne des Drachen. Der Titel ist also nicht nur dramaturgisch gewählt, sondern im übertragenen Sinn auch vollkommen richtig (wie sich noch herausstellen wird). Henk Kuijpers erzählt seine Geschichte um Franka auf gleich mehreren Ebenen. In der Gegenwart darf der Leser an ihrer Spurensuche teilhaben, die alles andere als einfach ist, da ihr Leben öfters bedroht wird. In der Vergangenheit warten verschiedene Ereignisse auf ihre Lüftung und in Zukunft wird, das deutet sich hier schon an, etwas geschehen, mit dem niemand gerechnet hat.
Kuijpers hat hier ein leichtfüßiges Abenteuer geschrieben. Er will unterhalten. Aber er fordert seinen Leser auch. Hier muss der Leser am Ball bleiben, denn viele, viele Fakten warten auf. Es geschieht sehr viel an allen Ecken und Enden. Die Rückblicke in die Vergangenheit bewerkstelligen diesen Kniff ohne aufdringlich zu sein. Vielmehr liest man weiter, blättert man weiter, bis irgendwann … leider schon alles vorbei ist. Denn ohne es zu merken, hat der Leser dieses Abenteuer, das auch eine Art Wettrennen ist, atemlos mitverfolgt. Kuijpers hat eine regelrechte Lehrgeschichte für Comic-Autoren geschrieben: Wie ziehe ich meine Leser in den Bann meiner Geschichte? Das ist ihm mit bestmöglicher Perfektion gelungen. Eine Gemeinheit erwartet den Leser nur am Schluss: Dieser ist nämlich keiner. Für das wahre Ende muss der Leser auf den 8. Band, Im Reich des Donnerdrachen zurückgreifen.
Vorher gibt es jedoch allerhand Schauplätze zu bestaunen, die Kuijpers auf seine gewohnt akribische Art umgesetzt hat. Vom Hafen in die Großstadt, ins Hotel und ab zu einer Verfolgungsjagd über die nächtlichen Dächer der Stadt. Wilde Prügeleien unter Frauen folgen, geradewegs ins Kino, wo einer jener Klassiker läuft, in dem sich eine Zeichentrickkatze und eine Zeichentrickmaus bekriegen. Frankas Gegenspielerin erinnert an eine böse Yoko. Kuijpers Mädels sind meist schlanke heiße Bräute. Der Kopf ist hier austauschbar. Das kann Kuijpers nicht angekreidet werden, denn die wenigsten Künstler im Comicfach leisten sich hier die Mühe für eine besondere Differenzierung.
Es ist auch deshalb nicht schlimm, da Kuijpers Qualitäten anderswo zu finden sind. Er ist ein Künstler, der sich nicht scheut, jeden noch so kleinen Platz für seine Darstellungen auszunutzen, aber zeigt doch immer nur das, was gerade benötigt wird. Da kann es schon einmal auf bis zu 15 Bilder pro Seite kommen, von denen manche Briefmarkenformat haben. Diese Technik funktioniert jedoch phantastisch, da Kuijpers mit filmischem Blick arbeitet, kleine Momentaufnahmen zeigt. Nur der Text bremst die raschen Aufnahmefähigkeit des Auges hier aus. Text gibt es reichlich. Kuijpers ist ein optischer Konstrukteur. Er schafft es gerade in Aktionsszenen weitestgehend ohne Text auszukommen, aber er ist auch ein Erzähler, der, wie es sich besonders in den Rückblicken in dieser Ausgabe zeigt, sehr weitschweifig und ausführlich sein kann. So pendelt das vorliegende Abenteuer zwischen kurzweiligen Sequenzen, in denen richtig was los ist und solchen, in denen man als Leser geduldig verweilen muss, um nichts zu verpassen.
Ein handlungsreiches und hintergrundvolles Szenario, wie es mancher abenteuerbegeisterte Leser von der Konzeption her aus Fernsehserien oder Romanen kennt. Hier ist es besser als erstere und mindestens ebenso gut wie zweitere. Hier warten Überraschungen und Wendungen auf jeder Seite, hier lässt Henrik Kuijpers seine Franka eine wahre Hindernisstrecke absolvieren. Von Europa nach Asien, Diebe, Verfolgungsjagden, Rätsel und mörderische Gegner inklusive. Klasse. 🙂
Franka 7, Die Zähne des Drachen: Bei Amazon bestellen
Freitag, 21. August 2009
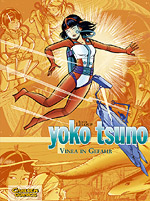 Tiphanol. Im gefrorenen Zustand sieht es auf diesem gammeligen Schrottplatz aus wie eine arg beschädigte Ansammlung von Kugeln. Doch sobald sie auftauen verwandelt sich Tiphanol in eine ungeheuer gefährliche und effiziente Säure. Yoko, Vic und Khany, die in dieser Umgebung auf ihre Raumanzüge angewiesen sind, halten sich an einem Ort auf, in dem scheinbar alles zur tödlichen Falle werden kann. Kurz darauf spürt ein robotischer Arbeiter die Eindringlinge in seinem Reich auf. Wieder einmal muss Yoko Reaktionsstärke beweisen. Unter erschwerten Bedingungen können sich die Freunde gegen den mechanischen Feind verteidigen, doch das ist erst der Anfang.
Tiphanol. Im gefrorenen Zustand sieht es auf diesem gammeligen Schrottplatz aus wie eine arg beschädigte Ansammlung von Kugeln. Doch sobald sie auftauen verwandelt sich Tiphanol in eine ungeheuer gefährliche und effiziente Säure. Yoko, Vic und Khany, die in dieser Umgebung auf ihre Raumanzüge angewiesen sind, halten sich an einem Ort auf, in dem scheinbar alles zur tödlichen Falle werden kann. Kurz darauf spürt ein robotischer Arbeiter die Eindringlinge in seinem Reich auf. Wieder einmal muss Yoko Reaktionsstärke beweisen. Unter erschwerten Bedingungen können sich die Freunde gegen den mechanischen Feind verteidigen, doch das ist erst der Anfang.
Vinea, genauer die Vineaner dürften zu den besten Einfällen im Comic-Genre, aber auch im Bereich Abenteuer und Science Fiction gehören. Mehrmals beweist Roger Leloup, der Vater von Yoko Tsuno, dass eine Erzählung, in der Yokos außerirdische Freundin Khany mitspielt, alle Möglichkeiten zulässt. Leloup hat sich selbst ein Fass der Ideen ohne Boden geschaffen, aus dem er eigentlich bis in alle Zeiten schöpfen kann, denn die Grenze ist das Weltall und das ist groß …
Waren bereits die ersten Episoden mit den Vineanern phantastisch genug, kann Leloup in den vorliegenden Geschichten ohne die störende Umgebung des Planeten Erde einmal mehr auftrumpfen. Die Technik der Außerirdischen ermöglicht es dem Autor und Zeichner seine Helden stets beweglich zu halten und mit immer neuen Spielzeugen auszustatten, ein Konzept, das auch in anderen Veröffentlichungen für Überraschungen sorgt (z.B. James Bond Gadges). In den hier drei vorliegenden Episoden kann er dazu aus dem Vollen schöpfen. Als Schauplätze dienen ein sumpfiges Land mit titanischen Bewohnern (Die Titanen), eine Art intergalaktischer Schrottplatz (Der vergessene Planet) sowie eine fremdartige Unterwasserumgebung (Die Stadt des Abgrunds).
Das Design der Vineaner ist meist sehr spitz, flach, rund mit Kanten, ein Stück Zukunftssicht der 70er Jahre ist darin zu finden. Leloup ist immer um Funktionalität bemüht und versucht seinen Konstruktionen einen Sinn zu geben. Er spielt damit und hat sich ihre Funktionalitäten sehr genau ausgedacht. Man mag dieses Design mögen oder nicht, ihre optische Funktionalität rückt so in den Bereich des Möglichen und stützt so die Glaubwürdigkeit der Geschichte. So sind die Abenteuer von Yoko Tsuno, so wie diese hier auch, keine 08/15 Space Opera Märchen im Sinne eines Star Crash, sondern mit viel Herzblut gestaltete Science Fiction Märchen. Derartige Komplexität findet sich im Comic-Genre nicht oft.
Technik ist eine Sache, das Abenteuer eine ganz andere. Das Design stimmt also. Leloup ruht sich allerdings nicht darauf aus. Für ihn ist die Umgebung (die ganzen Fahrzeuge, Gebäude usw. eingeschlossen) nur eine Plattform. Hier menschelt es auf erfrischende Weise. Yokos Freunde halten zueinander, Außerirdische wie Menschen. Yoko besitzt einen verbindenden Charakter, der fast an Winnetou erinnert. Sie ist edel im Gemüt, was sogar von fremden Kreaturen wie den Titanen, die alles andere als menschlich sind, erkannt wird. Auch Roboter lassen sich von Yokos Edelmut begeistern und überzeugen. Yokos Mut grenzt manchmal allerdings auch an Übermut oder auch Wagemut. Nicht jede Aktion ist gut durchdacht. Spontanität ist eines von Yokos Markenzeichen, aber auch eine ihrer Schwächen.
Die Gefahren, denen Yoko ausgesetzt wird, sind besonders in der letzten Geschichte Die vergessene Stadt sehr groß. Hier zieht Leloup alle Register. Unterseeische angriffslustige Tiere, angriffslustige Roboter, humanoide Feinde, ein sorgfältiges Rätsel und eine untergegangene und vergessene Kultur, die der Entdeckung harrt. Auch hierin, in der Ausarbeitung des gesamten Szenarios, liegen Leloups Qualitäten als Erzähler verborgen. Manchmal beweisen Yokos Feinde (in einem Spiel würde man sie Endgegner nennen) ein gewisses Einsehen. In den beiden ersten Episoden des vorliegenden Bandes ist das der Fall. Hier allerdings geht es schlussendlich um Kopf und Kragen. Leloup verpflichtet sich keiner erzählerischen Linie, erst recht keiner, die er selbst geschaffen hat. Dazu reicht seine Phantasie viel zu weit.
Eine wunderbare Arbeit Leloups in fremden Welten. Auf jeder Seite sind die Abenteuer faszinierend. Dank eines sehr durchdachten Aufbaus, der so viele Feinheiten der Geschichte wie möglich berücksichtigt, schafft Roger Leloup eine greifbare und packende Atmosphäre. Perfekt. 🙂
Yoko Tsuno Gesamtausgabe 4, Vinea in Gefahr: Bei Amazon bestellen
Dienstag, 18. August 2009
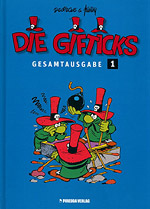 Ein Zeichner ohne Ideen? Ein Graus. Max Ariane (der hier erzählt und dessen Name vom Magazin Spirou geändert worden ist) befindet sich zwar an keinem künstlerischen Tiefpunkt, allerdings gibt es seitens des Verlages Forderungen, für die er gerade keine richtige Lösung parat hat. Er benötigt neue Figuren, frische Figuren, richtig gute Gegner für seine eigens ausgedachten Helden Pim und Puppi. Plötzlich, mittlerweile in höchster Verlegenheit angelangt, bringt sein Sohn ein Blatt mit nach Hause. Darauf sind drei kleine identisch aussehende Gestalten zu sehen. Die Gifticks steht zu den Figuren auf das Papier geschrieben. Und nicht nur das: Ihr unbekannter Künstler hat ihnen auch noch drei kleine Bomben dazu gezeichnet.
Ein Zeichner ohne Ideen? Ein Graus. Max Ariane (der hier erzählt und dessen Name vom Magazin Spirou geändert worden ist) befindet sich zwar an keinem künstlerischen Tiefpunkt, allerdings gibt es seitens des Verlages Forderungen, für die er gerade keine richtige Lösung parat hat. Er benötigt neue Figuren, frische Figuren, richtig gute Gegner für seine eigens ausgedachten Helden Pim und Puppi. Plötzlich, mittlerweile in höchster Verlegenheit angelangt, bringt sein Sohn ein Blatt mit nach Hause. Darauf sind drei kleine identisch aussehende Gestalten zu sehen. Die Gifticks steht zu den Figuren auf das Papier geschrieben. Und nicht nur das: Ihr unbekannter Künstler hat ihnen auch noch drei kleine Bomben dazu gezeichnet.
Max freut sich ganz einfach. Das Papier ist alt. Die Figuren werden es ebenfalls sein. Niemand wird es wohl aufregen, wenn er sie abzeichnet und für sein Projekt verwendet. Doch, wird es! Nämlich ihn selber! Kurz vor der Schlafenszeit schaut Max noch einmal nach seiner Kreation, aber das Papier ist leer. Dort, wo die Gifticks und ihre kleinen Bomben waren, sind die Figuren fein säuberlich entlang ihrer Konturen ausgeschnitten worden. Fortan häufen sich die unheimlichen Vorkommnisse und bald muss Max feststellen, dass es für ihn und seine Familie sogar um Leib und Leben geht.
Die Gifticks. Diesen Titel und Namen muss sich der Comic-Fan, der an komisch bösen Cartoons seine Freude hat, auf der Zunge zergehen lassen. Drei kleine Wesen haben nichts anderes im Sinn, als dem, der sie erweckt (und anderen), das Leben zur Hölle zu machen oder ihn gleich ganz um die Ecke zu bringen. Paul Deliege hatte die Idee zu diesen Gifticks. Ihre (genaue) Herkunft bleibt zunächst im Dunkeln. Mehr braucht es auch zu Anfang nicht. Sie sind da, sie machen Ärger und wie es sich bald herausstellt: Sie sind gemeingefährlich.
1976 erschienen ihre ersten Geschichten hierzulande auf Deutsch in Fix und Foxi. (Da werden ein wenig nostalgische Erinnerungen wach.) Besagtes deutsches Comic-Magazin war zwar nicht das einzige am Markt, aber sicherlich auf Augenhöhe mit seinem amerikanischen Konkurrenzprodukt. Und etwas wie die Gifticks gab es dort nicht. Diese drei kleinen Kerle, die von Deliege gezeichnet wurden und anfangs noch mit einer gewöhnlichen Metallschnalle am Hutband auftraten (erst später wurde daraus der signifikante Totenkopf) verbreiten nicht einfach nur das Chaos. Voller Überraschung konnte der jugendliche Leser hier miterleben, dass die kleinen Giftzwerge mit Pistolen umgingen.
Arthur Piroton übernimmt im ersten Abenteuer mit dem Titel Geheimnisvolle Bedrohung in diesem Sammelband die Zeichnungen der echten Menschen. Seine Arbeit ist auch gerade für diese Zeit (Entstehungsjahr: 1968) untadelig, aber das Gesamtergebnis ist hier noch nicht so rund, wie es eine Ausgabe später ist, nämlich mit Gefahr aus der Druckerpresse. Hier übernimmt Deliege die komplette Gestaltung und die Wirkung ist wie aus einem Guss. Die echten Menschen sind hier unwesentlich überzeichnet (man hätte annehmen können, Deliege kann das gar nicht). Gerade Jonas und sein Onkel, die sich hier hauptsächlich mit dem Gifticks auseinandersetzen müssen, bieten sehr schöne Identifikationen (gerade damals aus der Sicht von Kindern).
Drei Gifticks mit Getöse sind echt listick und auch böse …
Der Humor wird im zweiten Abenteuer auch deutlich größer geschrieben. Zuvor, im Auftakt, liegt der Schwerpunkt wirklich mehr auf der geheimnisvollen Bedrohung, während die Gifticks im zweiten Teil viel mehr zeigen dürfen, was sie drauf haben. Aus der all der Turnerei der Kleinen, ihren Ideen (wie sie zum Beispiel die Weltherrschaft erlangen wollen) und all den Anstrengungen, die sie in der Welt der Großen leisten müssen, um etwas zu bewegen (im wahrsten Sinne des Wortes), entsteht viel Situationskomik. (Man könnte meinen, es mit den Urahnen der Gremlins zu tun zu haben.) Spätestens, wenn die Gifticks mit Messer und Gabel angreifen, gibt es kein Halten mehr. Das hat ein wenig Peyo-Optik (Schlümpfe), wirkt aber fetter getuscht, ohne dass die Feinheiten vergessen werden.
Ein Klassiker des Humors, eine Komödie aus einer Hochzeit des Comics, die viele zeitlose Schöpfungen mit sich brachte. Die Gifticks: Man muss sie für das, was sie tun, hassen, aber andererseits sind sie furchtbar knuffick. Egal, ob man sie kennt oder nicht: Wer es humorick im Comic mag, sollte einen Blick riskieren. Comic-Nostalgiker sind hier sowieso absolut richtick. 🙂
Die Gifticks Gesamtausgabe 1: Bei Amazon bestellen
Montag, 17. August 2009
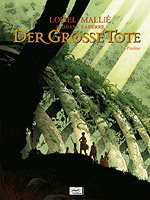 Pauline ist weg. Kaum sind die anderen von der Zeremonie im Kopf des großen Toten zurückgekehrt, ist sie verschwunden. Kurz zuvor ging es ihr nicht gut. Andauernd musste sie sich übergeben. Pauline sagt selbst, dass diese Übelkeit erst nach dem Trunk des letzten Absud vorkomme.
Pauline ist weg. Kaum sind die anderen von der Zeremonie im Kopf des großen Toten zurückgekehrt, ist sie verschwunden. Kurz zuvor ging es ihr nicht gut. Andauernd musste sie sich übergeben. Pauline sagt selbst, dass diese Übelkeit erst nach dem Trunk des letzten Absud vorkomme.
Aus einer Geschichte, die zu einem Fantasy-Abenteuer wurde, wird nun ein gesellschaftskritischer Abriss, der nicht sehr weit von der Realität entfernt scheint und deshalb umso erschreckender ist. Erwan ist zurück aus dem Land des kleinen Volkes. Letztlich hat er diese Welt nie verlassen, er wurde nur geschrumpft. Wer der große Tote ist (oder besser: war), erfährt der Leser zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, nur dass er eine Wende in die Zwistigkeiten des kleinen Volkes brachte und durch sein Auftauchen Frieden herbeiführte. Dieser Frieden ist nun in Gefahr.
Und mehr als das. In der eigenen Welt, der Welt der Großen, hat sich inzwischen das Chaos eingeschlichen. Arbeitslosigkeit, Armut und Obdachlosigkeit sind über ein Randthema weit hinausgewachsen. Die unterschiedlich schnell ablaufende Zeit hat Erwan und Pauline einen Teil der Entwicklung überspringen lassen. An manchen Orten ist es noch besser, wie auf dem Lande, doch in der Stadt ist das Elend an jeder Ecke deutlich sichtbar. Die Hiobsbotschaften, die täglich zu hören und zu lesen sind, tragen nicht dazu bei, Hoffnung aufkeimen zu lassen.
Aber die Bedürftigen werden immer zahlreicher. Und die, die was geben, werden immer weniger. Das geht so nicht weiter, glauben Sie mir!
Regis Loisel und JB Djian, die beiden für das Szenario verantwortlichen Autoren, beschreiben ein schleichendes Chaos, einen langsam, aber stetig ablaufenden Strudel der Ereignisse, dessen Langsamkeit scheinbar niemand etwas entgegenzusetzen hat. Mit der Verarmung greift die Verwahrlosung der Straßen um sich, Paris wird stellenweise zum Zeltplatz für Obdachlose. Sieht man von der Darstellung einer Demonstration ab, begehrt niemand auf. Die gesellschaftliche Situation ist zu einer erschreckenden Selbstverständlichkeit verkommen. Vor dieser Kulisse forscht Erwan nach Pauline, die kurz vor ihm zurückgekommen ist und durch die Zeitverschiebung einen enormen Vorsprung hat.
Die Vermischung von Fantasy und überspitzter gesellschaftlicher Realität in dieser Form ist fremd, neuartig, aber auch faszinierend. Nach dem Blick auf die Probleme mit einer elfengleichen Kultur bildet unsere Kultur einen absoluten Gegensatz. Letztlich stellt sich nur die Frage, welche Kultur die wildere, ursprünglichere der beiden ist. Loisel und Djian streuen ein Rätsel aus, zu dem der Leser sich seine eigenen Gedanken machen mag, denn selbst Erwan findet die Lösung in dieser Ausgabe nicht. Und so ganz nebenbei, ohne dass Erwan (obwohl er maßgeblich daran beteiligt ist) darauf eingeht, wird die Saat für eine weitere Handlung, ein weiteres Problem gelegt.
Während Loisel und Djian ausgetretene Erzählpfade verlassen, beschreitet Zeichner Vincent Mallie erprobte, aber auch sehr gute Wege. Er arbeitet mit leichter Hand. Gerade mit Erwan und Pauline, den beiden Hauptfiguren, sind ihm exzellente Charaktere gelungen, die eine schöne Lebendigkeit ausstrahlen. Ein wenig lässt sich Mallies Stirch mit dem von Angel Medina und Greg Capullo (Spawn) vergleichen. Der Aufbau insgesamt ist zart zu nennen, wenngleich Mallie deutlich weniger Striche ansetzt und der Bildaufbau dadurch insgesamt sehr ruhig wirkt und zum Hinschauen einlädt. Es gibt nichts, was das Auge ausblenden muss, um den Kern des Bildes einzufangen (wie das bei anderen Zeichnern manchmal der Fall ist, wie sie es zu gut meinen).
Die feine Strichführung wird durch eine ebenso feine Kolorierung von Lapierre gestützt. Die Farben sind kräftig, aber nicht übertrieben. Lapierre ist um echt wirkende Farben und Lichter bemüht. Das entspricht den Grafiken von Mallie, der nur bei seinen Figuren einen zeitweiligen satirischen Strich anwendet, ansonsten aber am Realismus zu bleiben versucht.
Ein sehr mysteriöses Abenteuer, das auf eine neue Handlungsebene wechselt: Von der Phantastik in die harte Realität, das war angesichts üblicher magischer Geschichten nicht zu erwarten und ist deshalb umso spannender. Loisel und Djian haben hier eine tolle Idee umgesetzt, von der sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen lässt, wie es weitergehen, geschweige denn ausgehen wird. Erste Klasse. 🙂
Der große Tote 2, Pauline: Bei Amazon bestellen
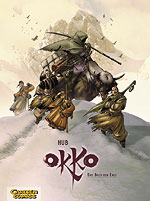 Die Frau, die in dem kleinen natürlichen Tümpel ein Bad nimmt, sieht wunderschön aus. Obwohl ein Makel diese Schönheit stört, ihr fehlt ein Arm, können die Männer nicht den Blick abwenden. Setzuka bemerkt die versteckten Männer bald. Sie erwidert die Blicke der ungebetenen Besucher stoisch. Nichts scheint ihre beherrschung durchbrechen zu können. Kurz darauf, Okko und seine kleine Gruppe wurden unter Setzukas Dach eingeladen, erfolgen wenig freundschaftliche Gespräche. Aber das alles spielt bald auch keine Rolle mehr. Das Lager wird angegriffen. Aus den Kriegern, die offensichtlich nicht viel füreinander erübrigen können, werden zwangsweise Verbündete: Die Toten greifen an!
Die Frau, die in dem kleinen natürlichen Tümpel ein Bad nimmt, sieht wunderschön aus. Obwohl ein Makel diese Schönheit stört, ihr fehlt ein Arm, können die Männer nicht den Blick abwenden. Setzuka bemerkt die versteckten Männer bald. Sie erwidert die Blicke der ungebetenen Besucher stoisch. Nichts scheint ihre beherrschung durchbrechen zu können. Kurz darauf, Okko und seine kleine Gruppe wurden unter Setzukas Dach eingeladen, erfolgen wenig freundschaftliche Gespräche. Aber das alles spielt bald auch keine Rolle mehr. Das Lager wird angegriffen. Aus den Kriegern, die offensichtlich nicht viel füreinander erübrigen können, werden zwangsweise Verbündete: Die Toten greifen an!









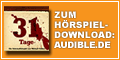

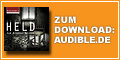
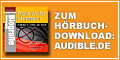



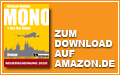
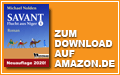
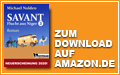
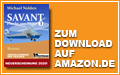
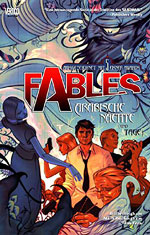
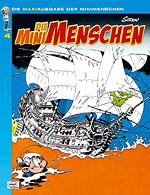
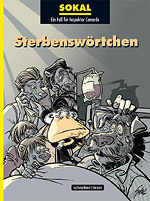
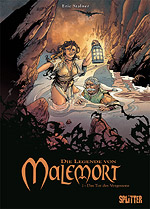
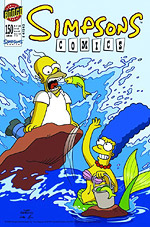 Däumelinchen erträgt es nicht mehr in ihrer Familie. Keiner bemerkt sie. Wenn sie bei Tisch etwas haben will, hört sie niemand. (Obwohl das eine von Homers Grundeigenschaften bei Tisch ist, denn da hat er immer nur das eine zu tun: Essen.) Das klitzekleine Mädchen verlässt das Elternhaus, nur um kurz darauf schon von einem Frosch gefressen zu werden. Und die Moral von der Geschichte … Nein, so schnell geht es dann doch nicht. Däumelinchen ist noch nicht tot. Sie darf zwar nicht spazieren gehen (Anspielung), aber soll verheiratet werden. Und so nimmt doch noch alles eine glückliche Wendung. So sind Märchen eben.
Däumelinchen erträgt es nicht mehr in ihrer Familie. Keiner bemerkt sie. Wenn sie bei Tisch etwas haben will, hört sie niemand. (Obwohl das eine von Homers Grundeigenschaften bei Tisch ist, denn da hat er immer nur das eine zu tun: Essen.) Das klitzekleine Mädchen verlässt das Elternhaus, nur um kurz darauf schon von einem Frosch gefressen zu werden. Und die Moral von der Geschichte … Nein, so schnell geht es dann doch nicht. Däumelinchen ist noch nicht tot. Sie darf zwar nicht spazieren gehen (Anspielung), aber soll verheiratet werden. Und so nimmt doch noch alles eine glückliche Wendung. So sind Märchen eben.